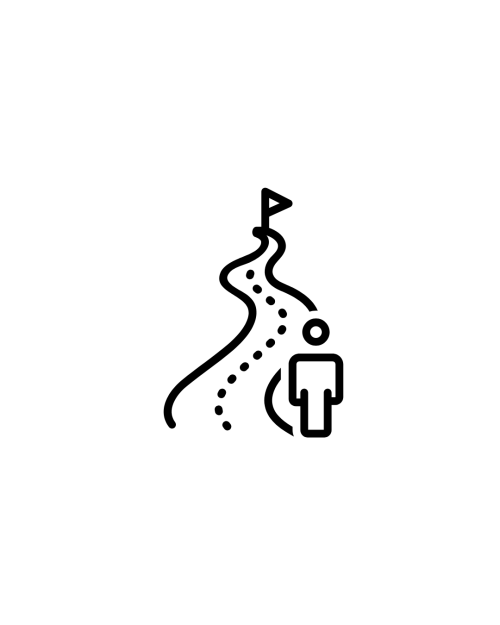Die erweiterte Anlage bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich: Sie trägt nicht nur zur Entlastung des städtischen Kanalsystems bei und so auch zum Überflutungsschutz vor Ort bzw. innerstädtisch, sondern fördert auch gezielt die Grundwasserneubildung. Ein weiterer positiver Effekt ist die Verbesserung des Mikroklimas auf dem Campus und im umliegenden Naherholungsgebiet der Lichtwiese.
Ökonomisch betrachtet führt das Projekt zu einer Substitution von Trinkwasser durch die Nutzung von Brauchwasser, was eine erhebliche Kostenersparnis bei Wasserverbrauch und Abwassergebühren zur Folge hat.
Ein besonders zukunftsweisender Aspekt ist die wissenschaftliche Begleitung durch die Forschungsgruppe Hydrogeologie der TU Darmstadt. Diese forscht zur künstlichen Grundwasseranreicherung – einem zentralen Baustein, um weltweite Trinkwasservorräte zu generieren und auch in Zukunft zu sichern. Lesen Sie hier das Interview mit Prof. Christoph Schüth zum Begleitprojekt nach. (wird in neuem Tab geöffnet)
Anhaltende Trockenphasen, erhöhte Hitzebelastung und punktuelle Starkregenereignisse oder Dauerregen, aber auch – noch nicht vorhandene – das Trinkwasser betreffende, regionale Engpässe sind hier besonders zu nennen. Insbesondere durch das Zurückhalten des Regenwassers vor Ort kann das städtische Kanalsystem entlastet und zum Überflutungsschutz in Darmstadt beitragen. Die Nutzung des Brauchwassers entlastet bereits jetzt die lokale Trinkwasserversorgung.
In einem ersten Schritt wurde die bestehende Brauchwasseranlage erweitert. Zwei weitere Versickerungsmulden sowie eine Flutmulde wurden im Gelände hergestellt. Auch die bestehenden Retentionsbecken wurden für den Überflutungsschutz saniert und ein ehemaliger Stauraumkanal zur Sammlung reaktiviert. In die Versickerungsmulden wurden 22 Einzelbrunnen gebohrt, durch die das natürlich gefilterte Wasser entnommen werden kann. Diese erweiterte Regenwasseranlage ist bereits in Betrieb.
Darüber hinaus sind weitere Vorhaben geplant, die schrittweise umgesetzt werden. Dazu gehören weitere gezielte bauliche Maßnahmen für einen besseren Überflutungsschutz der umliegenden Wohnbebauung sowie der Lehr-, Lern- und Forschungsgebäude. Die Infrastruktur des Brauchwassernetzes soll weiter ausgebaut und im Hinblick auf einen effizienteren Betrieb optimiert werden. Im Rahmen der Infrastruktur- und Grünplanung sollen möglichst Flächen entsiegelt bzw. bei Neubauten versickerungsfähig ausgebildet werden. Beispielsweise wurden in einem Infrastrukturprojekt kürzlich zwei der vier Spuren der Zufahrtsstraße zum Campus Lichtwiese zurückgebaut (wird in neuem Tab geöffnet) und die enstiegelten Flächen begrünt. Fassaden- und Dachbegrünungen sowie Retentionsdächer werden, wo möglich, nachgerüstet und bei allen neuen Bau- und Sanierungsprojekten geprüft und – wo möglich – umgesetzt.